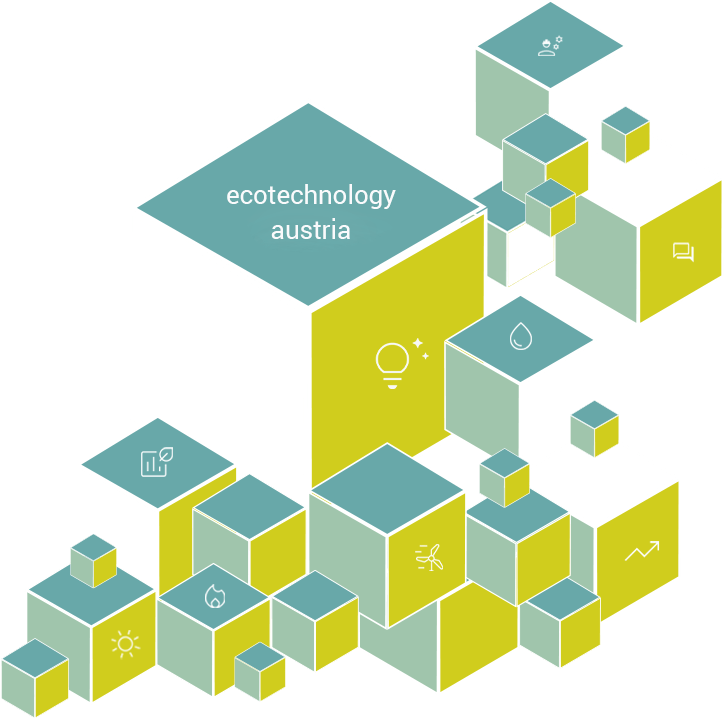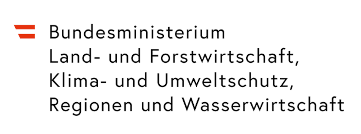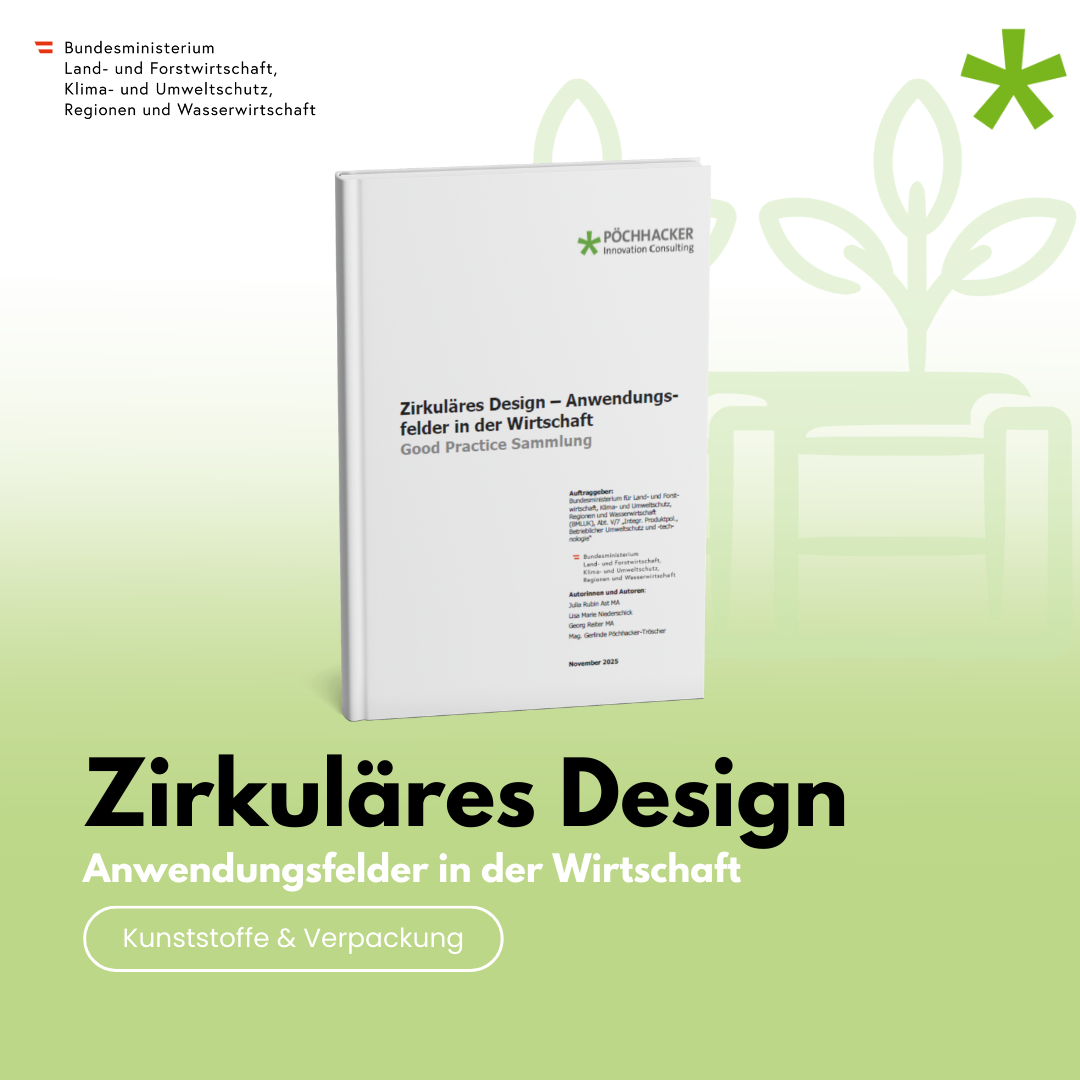Alle Komponenten sind so gestaltet, dass sie eine verlängerte Nutzungsdauer im Vergleich zu herkömmlichen Alternativprodukten ermöglichen und am Ende ihres Lebenszyklus in den Materialkreislauf zurückgeführt werden können. Bei der Materialwahl wird bewusst auf Verbundstoffe und Biokunststoffe, die nicht wiederverwertbar sind, verzichtet. Stattdessen werden sortenreine, recyclebare Kunststoffe verwendet, die eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine dementsprechend lange Verwendungsdauer aufweisen. Ergänzend dazu werden modulare Designprinzipien angewendet, um eine eigenständige Reparatur durch Kund:innen sowie beliebige Erweiterungen ermöglichen. Unterstützt wird dieser Ansatz durch eine zehnjährige Ersatzteilgarantie. Darüber hinaus eröffnet die konfigurierbare Bauweise die Möglichkeit einer flexiblen Anpassung, wodurch die kontinuierliche Nutzung über viele Jahre hinweg gefördert wird.
Zirkuläre Designprinzipien:
- Material – Design for Recycling
- Komponenten – Design for Repair / Maintenance
- Komponenten – Design for Upgrades / Customization
- Komponenten – Design for Longevity
- Systeme – Design for Collection and Recycling Systems
Dieses und weitere Good Practices finden Sie hier: https://www.ecotechnology.at/wp-content/uploads/2026/01/251121-BMLUK-Good-Practices-Zirkulaeres-Design-FINAL_bf.pdf