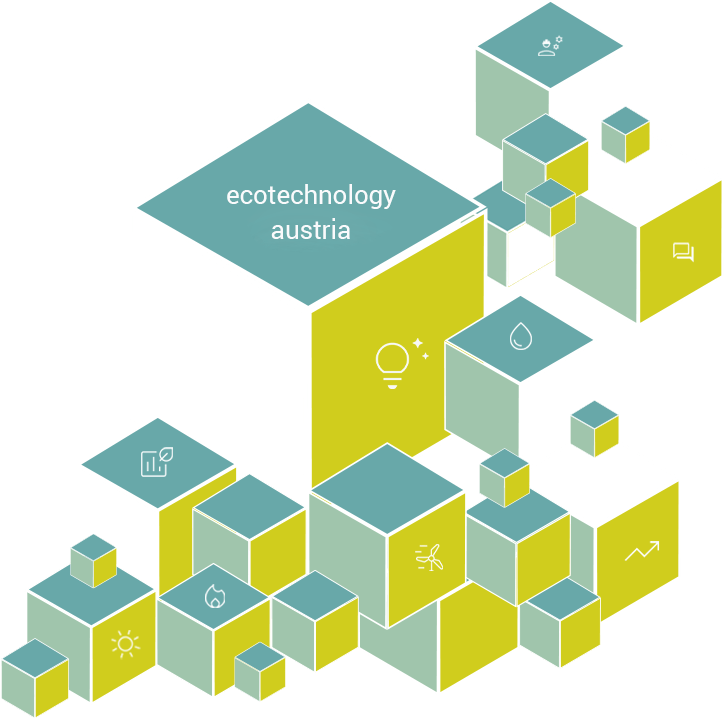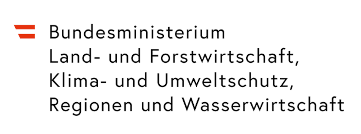Zirkuläres Design als strategischer Hebel
Design ist mittlerweile mehr als Form und Ästhetik. Es umfasst ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte und spielt eine zentrale Rolle für die Transformation von einer linearen zu einer zirkulären Wirtschaft. Zirkuläres Design setzt auf eine ganzheitliche Gestaltung entlang gesamter Produktlebenszyklen und Wertschöpfungsketten – von der Materialwahl über den Aufbau einzelner Komponenten bis hin zu Geschäftsmodellen und Rücknahmesystemen. Je nach Ebene kommen unterschiedliche Prinzipien zur Anwendung:
- Im Bereich „Material“ werden vier verschiedene Designprinzipien angeführt, welche sich zum Großteil mit der Schließung von Materialkreisläufen beschäftigen, diese sind Design for Biodegradability, Design for Recycling, Design with Recycled / Renewable Resources, Design for Resource Efficiency
- Auf Ebene der Komponenten finden vor allem fünf Designprinzipien Anwendung, durch welche eine verlängerte Lebensdauer erzielt wird: Design for Disassembly / Remanufacturing, Design for Repair / Maintenance, Design for Reuse, Design for Upgrades / Customization, Design for Longevity.
- Auf Ebene der Systeme werden übergeordnete Produktions-, Nutzungs- und Rückführungs-prozesse bzw. deren Systeme adressiert. Hier finden zum Beispiele Designkonzepte für ge-samte Wertschöpfungsketten oder zirkuläre Fertigungsanlagen Anwendung: Design for Resource / Production Efficiencies, Design for Collection and Recycling Systems, Design Take-back Systems, Design Products-as-a-Service, Design for Regeneration.
Alle weiteren Infos zu den Grundlagen und Prinzipien finden Sie ab Seite 8 im Guide: https://www.ecotechnology.at/wp-content/uploads/2026/01/251121-BMLUK-Good-Practices-Zirkulaeres-Design-FINAL_bf.pdf
Ab nächster Woche zeigen wir Ihnen, wie diese Prinzipien in der Praxis aussehen – mit Beispielen von österreichen Unternehmen.